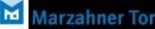Jahrbuch 2024
Historisches Jahrbuch Marzahn-Hellersdorf 2024

Inhalt
Inhalt
Olaf Michael OstertagVorwort
Karl-Heinz Gärtner Das Gut Hellersdorf zwischen 1872 und 1920
Ralf Protz Wohnen in Hellersdorf
Uwe Klett Neuland unterm Pflug oder Die Ebenen der Kommunalpolitik
Heinrich Niemann Gesundheit und Umwelt in Hellersdorf – Ideen, Projekte, Konflikte
Wolf R. Eisentraut Auf der Suche nach der verlorenen Mitte
Renate Schilling Der Jelena-Šantić-Friedenspark – Ein Zeugnis aktiver Friedensarbeit
Wolfgang Brauer Ein Berliner Geschichtsbuch „von unten“ – Der Parkfriedhof Marzahn
Helmut Drechsler Der Bau von Reihenhaussiedlungen im Angerdorf Kaulsdorf
Wolfgang Brauer Chronik 2023
Renate Schilling Straßenverzeichnis Marzahn-Hellersdorf / Ortsteil Hellersdorf 109
Abbildungsnachweis
Autorinnen und Autoren
Vorwort
Der vorliegende fünfte Band der Reihe „Historisches Jahrbuch Marzahn-Hellersdorf“ beschäftigt sich zentral mit dem Ortsteil Hellersdorf. 1375 erstmals urkundlich erwähnt –damals noch als „Helwichstorpp“ – kann der allgemein eher durch die Moderne und den DDR-Großsiedlungsbau bekannte Stadtteil nun auch schon auf stolze 650 Jahre aufgezeichnete Geschichte verweisen. Für den Heimatverein Marzahn-Hellersdorf e. V. ist das allemal Anlass, einige Referate vorzustellen, die zum Tag der Regional- und Heimatgeschichte 2024 vorgetragen wurden. Ergänzt wird die Sammlung durch Materialien, die schon traditionell die Bände unserer 2019 begonnenen Reihe vervollständigen: Aufsätze, die im abgelaufenen Jahr entstanden sind, eine Chronik und die als Nachschlagewerk geeignete Aufstellung der Straßenbenennungen in den jeweiligen Bauabschnitten der Großsiedlung. Hellersdorf hat in den letzten Jahrzehnten besonders viele „Stop-and-go“-Erfahrungen in seiner Baugeschichte machen müssen. Waren andere Bauvorhaben in Marzahn oder Hohenschönhausen schon fertiggestellt, hielten die Baukräne in Hellersdorf 1989/1990 erstmal an, bevor entschieden wurde, was überhaupt weitergebaut oder sogar wieder abgerissen wurde.
Ralf Protz vom Kompetenzzentrum Großsiedlungen gibt mit seinem Beitrag „Wohnen in Hellersdorf“ einen Überblick über die Entstehung der Großsiedlung Hellersdorf von den 1980er-Jahren bis zur Gegenwart. Dabei spielen Aspekte wie Bauen und Wohnen zum Ende der DDR und die gravierenden Veränderungen nach 1990, die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung der letzten 30 Jahre und die Wohnzufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner und Bauen in Plattenbauweise als internationales Phänomen eine Rolle. Ebenso rückt er soziale Fragen, wie z. B. die Mietenentwicklung bis heute, in den Vordergrund.
Ein besonderes Quartier in Hellersdorf ist das Gut Hellersdorf, das erst aktuell durch eine rege Neubautätigkeit ein ganz anderes Gesicht erhält. Anlass für unseren Ortschronisten Karl-Heinz Gärtner, in seinem detailreichen Beitrag „Das Gut Hellersdorf zwischen 1872 und 1920“ eine Vielzahl neuer Erkenntnisse zur Geschichte des Hellersdorfer Gutes, zur Kirchen- und Schulgeschichte zu vermitteln und interessierte Ortskundige so einzuladen, einen Bogen von der Geschichte in die Gegenwart zu schlagen.
Der an zentraler Stelle an der Planung beteiligte Architekt Wolf R. Eisentraut beleuchtet profund und kritisch die Zentrumsplanung „Helle Mitte“. Er geht dabei auf den Wettbewerb zur Gestaltung eines Zentrums für Hellersdorf, das zu DDR-Zeiten nicht mehr fertiggestellt worden war, ein. Das Siegerprojekt ist allerdings auch nicht wie entworfen umgesetzt worden, sodass der zentrale Platz in der Hellen Mitte ein Torso geblieben ist. An Beispielen aus anderen Städten verdeutlicht Prof. Eisentraut, was architektonisch angestrebt werden sollte. Basierend darauf entwickelt er Ideen und Vorschläge für eine städtebaulich harmonische Lösung für das Zentrum von Hellersdorf, die es lohnen, auch in der bezirklichen Baupolitik diskutiert zu werden.
Der ehemalige Bezirksbürgermeister Uwe Klett schildert in seinem Erlebnisbericht „Neuland unterm Pflug oder Die Ebenen der Kommunalpolitik“ seine Erfahrungen als Neuling im Amt eines Bezirksstadtrats und Bürgermeisters in Hellersdorf von 1992 bis zur Bezirksfusion 2001. Nach 1990 waren in einem unfertigen Bezirk und in einem gewandelten gesellschaftlichen Umfeld viele Dinge völlig neu zu lernen, aufzubauen und manchmal auch einfach nur vor der Abwicklung zu bewahren. Im Zusammenspiel mit der Zivilgesellschaft – ein Begriff, der sich mit der Zeit auch mehrfach wandelte – fand Klett so manche originelle oder auch unorthodoxe Wege. Ein bisher wenig bekanntes Kapitel in der neuesten Geschichte Hellersdorfs greift Renate Schilling in ihren Beitrag „Der Jelena-Šantić-Friedenspark – Ein Zeugnis aktiver Friedensarbeit“ auf. Der Jelena-Šantić-Friedenspark wurde 2003 nach einer serbischen Friedensaktivistin benannt. Vorher hieß die Grünfläche, die durch den Aushub für das Zentrum Helle Mitte in der Nähe der heutigen Seilbahnstation entstanden war, Rohrbruchpark. Der Namensgebung vorausgegangen war im Mai 1999 die Einpflanzung eines weithin sichtbaren „Peacezeichens“, vor allem durch junge Menschen. An dieser Aktion hatte Jelena Šantić teilgenommen. Das auffällige und insbesondere in der Blühphase auch sehr ästhetische Peacezeichen wurde als Symbol des Protestes gegen die Beteiligung der NATO am Krieg in Ex-Jugoslawien, aber auch als Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten angelegt.
Der ehemalige Gesundheitsbezirksstadtrat Heinrich Niemann schildert im Beitrag „Gesundheit und Umwelt in Hellersdorf – Ideen, Projekte, Konflikte“ seine Erfahrungen als ehemaliger Bezirksstadtrat in Hellersdorf. Besonders hebt er die Projekte hervor, die in dieser Zeit geplant und umgesetzt wurden, wie regelmäßige Berichterstattungen und Analysen, Möglichkeiten und Grenzen des öffentlichen Gesundheitswesens, Verbesserung der medizinischen Versorgung, der Erhalt des Hellersdorfer Krankenhauses. Auch aus diesen Erfahrungen lässt sich für die Gegenwart, in der erneut die Streichung der wohnortnahen Versorgung geplant wird, lernen. An diese „Hellersdorfer“ Beiträge schließen sich die weiteren Artikel an:
Helmut Drechsler, er lebt in Kaulsdorf, hat die Baugeschichte der Reihenhaussiedlung in Kaulsdorf recherchiert und aufgezeichnet. Diese in den 1980er Jahren errichtete Siedlung ordnet er ein in das Wohnungsbauprogramm der DDR. Im Rahmen dieses Programms baute das damalige Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 1975 in Kaulsdorf neun freistehende Einfamilienhäuser und acht Doppelhäuser (Brodauer Straße/Wapplitzer Straße). 1985/86 folgten 56 Reihenhäuser, damals errichtet von der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB). Mit diesem Beitrag wird erstmals diese Phase der Besiedlung von Kaulsdorf faktenreich aufgearbeitet.
Unser langjähriger Vorsitzender, der Historiker Wolfgang Brauer, veröffentlicht mit seinem Beitrag „Ein Berliner Geschichtsbuch ‚von unten‘ – Der Parkfriedhof Marzahn“ die Ergebnisse seiner umfangreichen Forschungen zur Geschichte der Grabanlagen. An zahlreiche Gräuel wird durch die verschiedenen Gedenksteine erinnert, und gerade neuerdings wird Erinnerung wieder verstärkt zur Politik. Dass dies der Würde der Opfer widerspricht, das muss leider wieder laut ausgesprochen werden. Wolfgang Brauer zeigt mit seiner faktenreichen und umfassenden Darstellung auf, dass auf dem Parkfriedhof Marzahn die Geschichte Berlins im 20. Jahrhundert deutlicher als anderswo ablesbar ist.
Fortgeführt wird von Wolfgang Brauer auch die Chronik mit den bezirklich bedeutsamen Ereignissen von 2023.
Abgeschlossen wird die Ausgabe mit dem schon eingangs erwähnten Straßenverzeichnis, zusammengetragen von Renate Schilling.
An dieser Stelle danke ich insbesondere allen Autoren und den redaktionell und gestalterisch tätigen Mitwirkenden an diesem „Historischen Jahrbuch Marzahn-Hellersdorf 2024“:
Wolfgang Brauer und Ninon Suckow für die Konzeption, Redaktion und das Lektorat, meinem Stellvertreter Claas Reise und unserer Schatzmeisterin Dr. Renate Schilling für die organisatorische und rechtliche Absicherung dieses Bandes, und Vija Kasparson, die erstmals das Layout für ein Buch des Heimatvereins Marzahn-Hellersdorf e. V. gestaltet hat. Herzlichen Dank natürlich auch an die Druckerei. Wir danken allen, die uns großzügig die Nutzung ihrer Bildquellen gestatteten.
Mit diesem Jahrbuch hoffen wir, nach den unruhigen Jahren der Corona-Pandemie, die zum Ausfall von vielen unserer Veranstaltungen geführt hatte, wieder in eine stabilere Phase einzutreten. Wir hoffen, damit Ihr Interesse an Regional- und Heimatgeschichte zu wecken oder aufzufrischen und laden Sie zur Mitarbeit im Heimatverein ein. Der vorige Band war – als Doppelausgabe für die Jahre 2022/2023 – deutlich umfangreicher als der vorliegende. Wir, die Herausgeber und Autoren, sind daher für Anregungen zu weiteren interessanten Themen zur historischen Aufarbeitung oder Ihre eigenen Beiträge dankbar. Melden Sie sich bei uns oder besuchen Sie uns bei Vorträgen, Exkursionen oder dem nächsten „Tag der Regional- und Heimatgeschichte“.
Olaf Michael Ostertag
Vorsitzender des Heimatvereins Marzahn-Hellersdorf e. V.
Berlin, Februar 2025